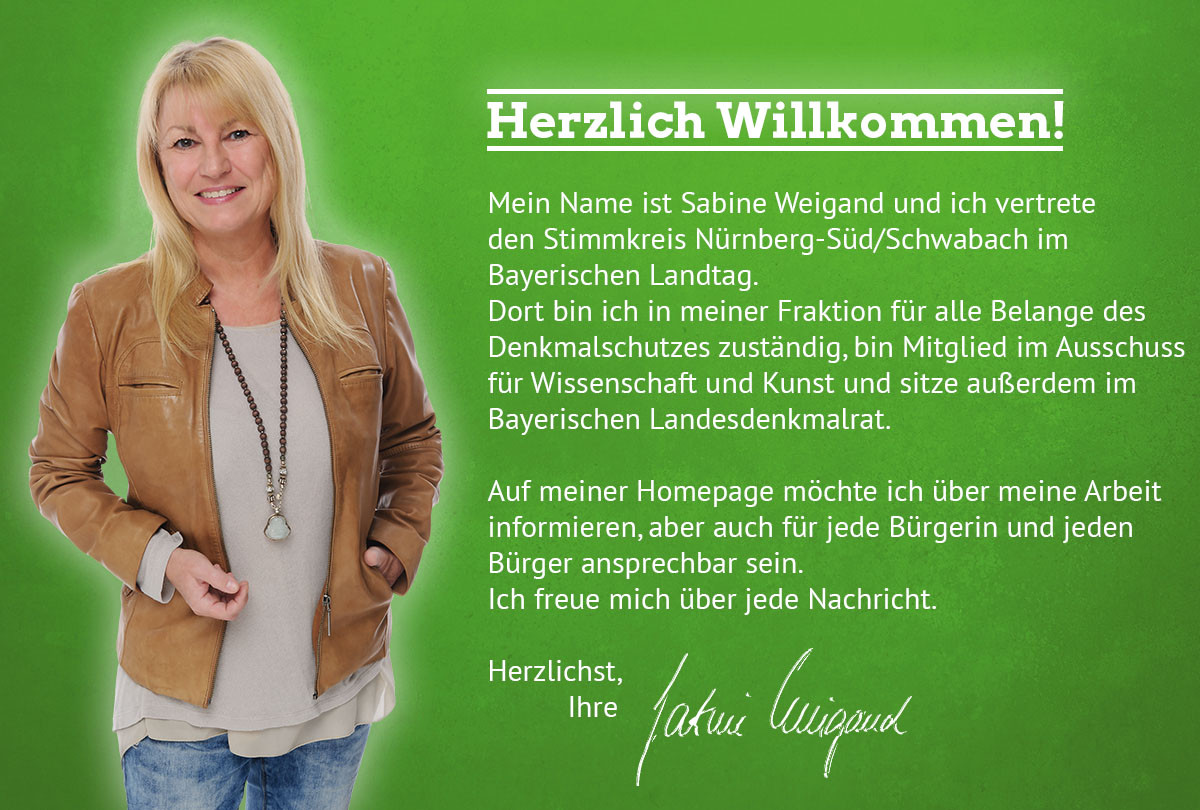Die Kirche im Dorf lassen
Denkmalschutztour 2025 gestartet
30.06.25 –
Dr. Sabine Weigand, denkmalpolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag, startet in diesem Sommer zu ihrer 7. Denkmalschutztour durch den Freistaat. 2025 stehen Kirchen im Mittelpunkt. Aus gutem Grund, denn immer mehr sakrale Gebäude werden nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Fachleute gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren jede vierte bis fünfte Kirche leerstehen wird - in Bayern rund 2500 Gotteshäuser.
Sakrale Räume sind Orte der Sinnstiftung und des sozialen Miteinanders. Sie gehen uns alle an. Deshalb kann es nur in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs gelingen, neue Nutzungen für Kirchen zu finden. Sabine Weigand und ihr Team besuchen denkmalgeschützte Kirchen, die bereits umgenutzt sind oder über deren Transformation gerade in den Gemeinden und Orten lebhaft diskutiert wird. Ziel ist es, aus den Praxisbeispielen Ideen mitzunehmen und die politische Debatte über die Umnutzung sakraler Räume voranzutreiben.
Der Auftakt der Denkmalschutztour hätte nicht besser gewählt werden können. Die Kirche St. Anton in Schweinfurt hat den Transformationsprozess, der vielen Kirchengemeinden noch bevor steht, bereits äußerst erfolgreich vollendet.
"Vor der Welle bleiben"
St. Anton wurde in den Nachkriegsjahren als Franziskanerkloster erbaut und mit einem imposanten Kirchenraum ausgestattet. Bereits um 2010 war klar, dass der Komplex in der vorliegenden Form nicht sinnvoll weiter existieren kann und dass Ideen für eine Umnutzung nötig sind. Gemeindeleiter Diakon Joachim Werb, der Sabine Weigand und ihr Team sowie den MdL-Kollegen Paul Knoblach empfing, formulierte dazu, man habe versucht, „vor der Welle zu bleiben“.
Das hat geklappt, denn die Diözese stellte die imposante Summe von 17 Millionen Euro zu Verfügung und verkündete kurz danach ein Baumoratorium – angesichts der Dimension der Aufgabe nachvollziehbar.
Von Anfang an dabei war Architekt Christian Brückner (Brückner & Brückner Architekten, Würzburg/Tirschenreuth). Er fand eine viel zu große Kirche vor und ein dünn belegtes Kloster. Sein Ziel war es, wieder Leben in das Ensemble zu bringen unter Berücksichtigung aller relevanten Akteure. Es entwickelte sich ein dynamischer Prozess zwischen der Diözese, der Kirchengemeinde, der Stadt, dem Denkmalschutz und weiteren Trägern öffentlicher Belange.
Das Ergebnis war ein sozial-karitatives Zentrum, das die Koordinatorin Marion Hammer vorstellte. So konnten ein Kinderhaus untergebracht werden mit Früherziehung und Förderschule, das von der Caritas getragene Casa Vielfalt ermöglicht Begegnungen, vor allem auch im interkulturellen und interreligiösen Kontext, und in dem direkt benachbarten Caritas-Seniorenheim Marienstift werden Begegnungsmöglichkeiten angeboten. Als Abrundung bietet ein Inklusionscafé auch noch einen gastronomischen Service an.
Zum interreligösen Kontext gehört auch die griechisch-orthodoxe Kirche, eine Art Höhlenkirche unter dem Vorplatz von St. Anton. Diakon Werb machte klar, dass der interreligöse Dialog nur funktioniert und akzeptiert ist, weil er von Sozialpädagogen getragen ist. Ein Geistlicher könne sich an dieser Stelle nicht in den Vordergrund stellen.
150 statt 700 Plätze in der Kirche
Die Baumaßnahmen führten zu einer Reduzierung des Kirchenraums. Besonders beeindruckend war die Rückversetzung des kompletten Fensters über der Vorderfront, so dass das Fenster auch nach dem Umbau das Ende des Sakralraums darstellt. Der Sakralraum selbst wurde um 1,30 Meter angehoben, so dass ein barrierefreier Zugang entstand. Statt 700 Plätzen stehen nur nur 150 Plätze zu Verfügung, was „inzwischen ausreichend ist“, bedauerte Diakon Werb, „aber die im Halbkreis („Omega“) um den zentralen Altar angeordneten Stühle bieten liturgisch ganz neue Möglichkeiten.“ Im ehemaligen Vorderteil der Kirche wurden Zwischenböden eingezogen und Veranstaltungsräume geschaffen.
Die früheren Klostermauern sind damit ein Ort der Begegnung von Kulturen, Religionen und Generationen geworden, was „innovativ für die Kirche und die Stadt ist“, so Werb. Dazu gehört auch das Programm, das immer am Bedarf ausgerichtet werden muss, um attraktiv – auch für Spenden – zu bleiben“, ergänzte Hammer. Architekt Brückner freute sich, dass „Geschichte gerettet wurde und graue Energie mit Augenmaß saniert werden konnte“. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem damals zuständigen Gebietsreferenten des Landesamts für Denkmalpflege, Herr Haas, zusammen habe man sich die die Maxime „Denkmalentwicklung vor Nur-Denkmalpflege“ zu eigen gemacht.
Kategorie
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.